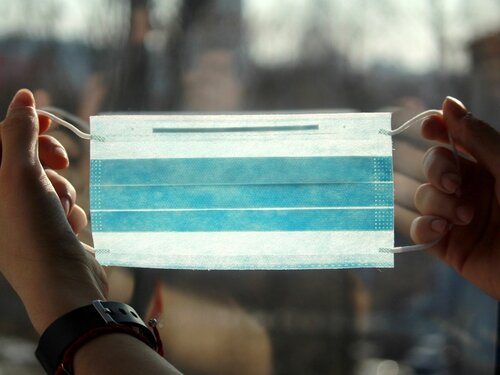Die epidemiologische Situation von COVID-19 hat sich mittlerweile stark verändert. SARS-CoV-2 ist von der pandemischen in die endemische Phase übergegangen, d.h. das Virus zirkuliert weiterhin in der Bevölkerung. "Endemisch" bedeutet laut Robert-Koch-Institut nicht, dass das Coronavirus harmlos wird. Wie das RKI mitteilt, wird es höchstwahrscheinlich weiterhin zu Ausbrüchen und Erkrankungswellen kommen. Vor allem in der älteren Bevölkerung und bei Menschen mit bestimmten Grund- und Vorerkrankungen sei auch in Zukunft mit schweren Verläufen zu rechnen. Das Risiko für schwere Erkrankungen lässt sich durch eine Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) und insbesondere eine Auffrischimpfung (drei- oder viermalige Impfung) wesentlich reduzieren.
Viele Menschen, insbesondere Betroffene, die an einer entzündlich-rheumatischen Krankheit leiden, haben Angst, sich anzustecken und einen schweren Verlauf bei einer Erkrankung zu haben.
Wer ist besonders gefährdet für einen schweren Verlauf?
- Besonders gefährdet sind ungeimpfte oder unvollständig geimpfte Personen. Obwohl die Impfung keinen vollständigen Schutz gegen alle Varianten des SARS-CoV-2 Virus verleiht, schützt sie zumindest weitgehend vor einem schweren Krankheitsverlauf und der Notwendigkeit einer Hospitalisierung. Auch bei Patienten mit Risikofaktoren wie einem geschwächten Immunsystem reduziert die komplette Grundimmunisierung (erste und zweite Impfung) mit mindestens einer Auffrischimpfung die Wahrscheinlichkeit eines schweren COVID-19-Verlaufs deutlich.
- Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen, die keine Impfantwort (Antikörperbildung) zeigen.
- Das Risiko für einen schweren Verlauf steigt für Menschen ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren stetig an.
- Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, vor allem bei chronischen Erkrankungen des Herzens, der Lunge, der Niere, bei chronischen Lebererkrankungen, Diabetes, starkem Übergewicht, Trisomie 21 und Krebs: Bei Zusammentreffen von Grunderkrankungen und höherem Alter erhöht sich das Risiko weiter. Einige dieser Vorerkrankungen treten bei Rheumapatienten häufiger auf als im Bevölkerungsdurchschnitt. Sie dürfen daher nicht außer Acht gelassen werden.
- Männer erkranken jedoch häufiger schwer und sterben laut einer Übersichtsarbeit doppelt so häufig wie Frauen.
- Raucherinnen und Raucher
- Die Erkenntnis, inwieweit Rheumapatienten ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 haben, hat sich seit Beginn der Pandemie leicht gewandelt und kann noch nicht abschließend beantwortet werden.
- Das Robert-Koch-Institut (RKI) rechnet Patienten mit geschwächtem Immunsystem oder Autoimmunerkrankungen (inkl. Personen mit rheumatologischen Erkrankungen) zur Personengruppen, bei welcher schwere Krankheitsverläufe häufiger beobachtet werden. Dazu zählen z.B. Patienten mit regelmäßiger Einnahme von bestimmten Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. systemische Kortikosteroide („Kortison“), Methotrexat, Cyclophosphamid, Azathioprin und Antikörper wie Rituximab. Die DGRh geht etwas genauer auf die Liste von entsprechen Medikamenten ein (siehe unten).
- Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie weist darauf hin, dass die bisherigen Erkenntnisse aus Studien zu COVID-19 nahelegen, dass im Allgemeinen das Risiko für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung bei Rheuma-Patienten in der Regel nicht höher zu sein scheint als bei der Allgemeinbevölkerung. Es gibt jedoch Besonderheiten:
- Wenn die Erkrankung gerade besonders aktiv ist (u.a. weiter geschwollene Gelenke, erhöhte Entzündungszeichen im Blut), scheint das Risiko für einen schweren Verlauf erhöht zu sein.
- Außerdem liegt möglicherweise bei Systemerkrankungen wie Vaskulitiden, Kollagenosen (insbesondere Systemischer Lupus erythematodes, Systemische Sklerose, Sjögren-Syndrom) sowie autoinflammatorische Erkrankungen ein höheres Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf vor. Die hierzu verfügbaren Daten sind bisher noch nicht so belastbar wie die Daten zur rheumatoiden Arthritis (Stand Juni 2021).
- Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Patienten, die Rituximab einnehmen, ein erhöhtes Risiko für schwerere Verläufe von COVID-19 haben. Wenn Sie Rituximab einnehmen, sprechen Sie mit dem behandelnden Rheumatologen, ob die Einnahme z.B. verschoben werden kann, bis ein Impfschutz aufgebaut werden konnte. Wenn Rituximab bei lebensbedrohlichen Verläufen von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen eingesetzt wird, empfehlen die Experten dringend, das Medikament auch weiter einzusetzen. Auch für Rituximab gilt: Setzen Sie auf keinen Fall die Medikamente ohne Rücksprache mit Ihrem Rheumatologen ab!
- Die folgenden Therapien scheinen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf der COVID-19 Erkrankung einherzugehen: Cyclophosphamid, Mycophenolat, Glukokortikoide („Kortison“; ab 10 mg /Tag), JAK-Inhibitoren (Baricitinib, Tofacitinib, Filgotinib und Upadacitinib), Ciclosporin A, Tacrolimus, Azathioprin (mehr als 3mg/kg Körpergewicht), Rituximab (siehe oben) und Abatacept.
- Weitere Informationen zu den Risikogruppen finden Sie hier: Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit auf der Internetseite des Robert-Koch-Institus; Handlungsempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie für die Betreuung von Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen im Rahmen der SARS-CoV-2/COVID-19-Pandemie einschließlich Empfehlungen zur COVID-19 Impfung; Patientenversion der Handlungsempfehlungen; Empfehlungen der DGRh zur Prophylaxe und Behandlung einer frühen COVID-19 Infektion bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf.
Behandlung von COVID-19 bei Rheumapatienten mit einem Risiko für einen schweren Verlauf
- Bei Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 (siehe oben) sollte nach Infektion mit dem Corona-Virus, die mit Symptomen von COVID-19 einhergeht, in Absprache mit dem Rheumatologen eine Behandlung erwogen werden. Die medikamentöse antivirale Therapie sollte möglichst innerhalb von 5 bis 7 Tagen nach Symptombeginn beginnen.
- Hinweise und Empfehlungen zur Therapie oder passiven Immunisierung finden sich bei der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und beim Robert-Koch-Institut.
Welchen Stellenwert hat die Therapie entzündlicher Rheumaerkrankungen?
- Wenn eine entzündlich-rheumatische Erkrankung neu festgestellt wird, ist es wichtig, dass die medikamentöse Behandlung so schnell wie möglich beginnt. Wenn die Therapie gegen entzündliches Rheuma bereits läuft, sollten Sie die Therapie nicht eigenmächtig unterbrechen.
- Immunsuppressiva (zum Beispiel Kortison, Methotrexat, Biologika, JAK-Inhibitoren) sollten keinesfalls ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt abgesetzt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie warnt ausdrücklich vor dem eigenmächtigen Absetzen der Therapie. Eine aktive, unbehandelte entzündliche Rheumaerkrankung ist in der Regel gefährlicher für eine Ansteckung mit einer Viruserkrankung als ein mit immunsuppressiven Medikamenten gut eingestelltes entzündliches Rheuma. Würde nach dem Absetzen ein Schub erfolgen, könnte sogar eine Erhöhung der immunsuppressiven Therapie und insbesondere der Kortisondosis nötig werden, was das Immunsystem möglicherweise ungünstig beeinflussen könnte.
- Rheumapatienten, die Rituximab einnehmen, sollten mit dem behandelnden Rheumatologen besprechen, ob die Einnahme z.B. verschoben werden kann, bis ein Impfschutz aufgebaut werden konnte. Auch für Rituximab gilt: Setzen Sie auf keinen Fall die Medikamente ohne Rücksprache mit Ihrem Rheumatologen ab!
- Bei Zeichen einer Infektion sollten Menschen mit erhöhtem Risiko frühzeitig telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen, nicht direkt in die Praxis gehen.
- Sollte tatsächlich eine Infektion mit dem Coronavirus bei Betroffenen mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen festgestellt werden, sollte telefonisch Kontakt mit dem Rheumatologen aufgenommen werden, um zu besprechen, wie die Therapie verändert werden muss; etwa wenn eine Corona-Infektion mit absehbar schwerem Verlauf vorliegt.
- Rheumapatienten, die über längere Zeit (zum Beispiel mehr als einen Monat) Kortison einnehmen, verlieren die Fähigkeit, auf eine Stress-Situation wie eine Infektion mit dem Coronavirus ausreichend zu antworten. Dies gilt insbesondere, wenn Fieber, eines der wichtigsten Symptome der Corona-Infektion, auftritt. Die Nebennierenrinde ist durch die lange Kortison-Therapie ruhiggestellt. Sie kann nicht ausreichend durch Produktion von Kortisol reagieren. Diese Patienten brauchen dringend den Rat ihres Rheumatologen oder den Rat eines Endokrinologen (Hormonspezialist). Auf keinen Fall darf das Kortison ohne Rücksprache abgesetzt werden!